
Haus der Ministerien (Leipziger Straße) nach Verhängung des Ausnahmezustandes. Hier: Wilhelmstraße.

Sowjetische Soldaten und Volkspolizei in der Ruine des Hotels Fürstenhof, Potsdamer Platz.

Bezirk Tiergarten, Potsdamer Straße Ecke Stresemannstraße.

Unter den Linden, Bezirk Mitte. Vopos sehen dem Demonstrationszug zu ohne einzugreifen. Vorne links: Ein Westberliner Journalist der einen Bericht verfasst.

Sowjetische Panzer und Rotarmisten am Pariser Platz, Unter den Linden.

Lockerung der Sektorenabsperrung. Ausgabe von Tagespassierscheinen, Bernauer Straße.

Demonstranten am Potsdamer Platz, Bez. Mitte. Die Sektorenschilder wurden niedergerissen.

Brennender Zeitungskiosk und Propagandamaterial auf dem Potsdamer Platz, Bez. Mitte.

Der 17. Juni 1953 auf dem Potsdamer Platz, Bez. Mitte.

Brand im Columbushaus, Potsdamer Platz.

Ein Arbeiterstreik um Normenerhöhung in Ost-Berlin weitete sich zu einer Volkserhebung in der gesamten Deutschen Demokratiscfhen Republik (DDR) aus. Hier: Das brennende Columbiahaus am Potsdamer Platz.

Aus: „Der Stacheldraht“. Die Arbeiter von Hennigsdorf marschieren bis ins Stadtzentrum von Berlin.

Quelle: Jürgen Ritzschke, W.H. und die roten Teufel.
Fotos zur Schandmauer

Zwei Flüchtende durchbrachen mit einem Lastwagen die Sperrmauer an der Sektorengrenze in der Boyenstraße, Bez. Wedding im April 1962.


Zerstörte Sperrmauer nach dem Durchbruch eines Flüchtlings an der Grenze Bethaniendamm, Bez. Kreuzberg am 28.4.1963.

Mahnmal der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) am Steinplatz, Charlottenburg.
Abriegelung des Sowjetsektors - 13. August 1961

Flucht aus dem Ostsektor durchs Fenster. Der Bürgersteig vor dem Haus in der Bernauer Straße gehört zum Westsektor.

Zwei Bürger der DDR zwangen eine polnische Verkehrsmaschine zur Landung in West-Berlin. Die Maschine auf dem Flugplatz Tegel am 19.10.1969.

Grenzsoldaten entdecken (einen Tag vor der Benutzung) einen Fluchttunnel in der Brunnen- Ecke Bernauer Straße. Bildaufnahme: 25.2.1971

Bergung eines von Volkspolizisten erschossenen Flüchtlings aus dem Humboldthafen, Bez. Mitte. Aufnahme: 27.8.1961

Grenze nach Ost-Berlin. Bürger, die einen Fluchtversuch von Ost- nach West-Berlin unternahmen, werden verhaftet und abgeführt, gesehen von der Dresdener Straße, Bez. Kreuzberg. Aufnahme: 16.8.1962

Grenze zur DDR, Kreis Nauen. Fünf Zonenbewohner flüchteten mit einer gepanzerten Planierraupe durch die Stacheldrahtsperren der Grenze nach West-Berlin, Bezirk Spandau, Finkenkruger Weg. Aufnahme: 11.9.1966

Grenze nach Ost-Berlin, Bezirk Neukölln, Heidelberger- Ecke Elsenstraße. Nach der Flucht eines 19jährigen Ost-Berliners wird die Durchbruchstelle in der Sperrmauer wieder geschlossen. Aufnahme: 18.4.1963

Nach der Flucht eines 19jährigen Ost-Berliners wird die Durchbruchstelle in der Sperrmauer an der Heidelberger- Ecke Elsenstraße, Bez. Treptow, von der Volkspolizei wieder vermauert. Hier: West-Berliner Zuschauer im Bezirk Neukölln. Aufnahme: 18.4.1963

Flucht von Ost- nach West-Berlin. Heinrich Alberts (Senator für Inneres) besucht einen bei der Flucht schwer verletzten 15jährigen Jungen im Städtischen Krankenhaus Moabit, Bez. Tiergarten. Aufnahme: 28.5.1962

Senator Exner besucht einen bei der Flucht schwer verletzten Jungen an seinem 15. Geburtstag. Aufnahme: 25.7.1962.


Gustav Rust beim ausmalen der Schrift auf der Gedenkplatte auf dem Bürgersteig in der Bernauer Straße 2001.

Rechts: Eine der drei Glocken der Versöhnungskirche in der Bernauer Straße. Die Glocken waren ein Geschenk des Bochumer Vereins an die Versöhnungsgemeinde.

Der Spiegel, Marinetta Jirkowski, 13.08.2010 Marienettas verschollene Bilder Von Stefan Appelius


Text zum Gedenkkreuz (Bild rechts):
Zum Gedenken: Dieses Kreuz wurde Anfang Februar 1981 zur Erinnerung an Marienetta Jirkowsky unweit der Stelle errichtet, an dem das junge Mädchen beim Fluchtversuch eine tödliche Schussverletzung erlitt. Bereits einen Monat später wurde es von einem Agenten der Staatssicherheit, "IMB Brunnen", gestohlen und in die DDR transportiert. Foto: Lutz-Peter Naumann
In Hohen-Neuendorf bei Berlin wird am Jahrestag des Mauerbaus ein Platz nach Marienetta Jirkowsky benannt. Angehörige und Politiker stritten lange über den symbolischen Akt zu Ehren der jungen Frau. Die Staatssicherheit hatte alle Erinnerungen an sie tilgen wollen - doch nun sind verschollen geglaubte Fotos aufgetaucht.
Bärbel Kultus wollte nicht, dass man sich an ihre Nichte erinnert. Angeblich hätten es auch die verstorbenen Eltern des jungen Mädchens nicht gewollt. Diese Geschichte sei ihre Privatsache und gehe niemanden etwas an, schimpfte die alte Dame. Andere hätten es viel eher verdient, dass ein Platz nach ihnen benannt werde.
Das junge Mädchen wurde vor dreißig Jahren in Hohen-Neuendorf erschossen - beim Versuch, aus der DDR zu flüchten. Marienetta Jirkowsky, 18 Jahre alt, träumte von einem gemeinsamen Leben mit ihrem Freund in Freiheit. Nach ihrem Tod sammelte die Staatssicherheit alle Bilder ein, die es von Jirkowsky gab. Nichts sollte an das Mädchen erinnern.
In Hohen-Neuendorf wird an diesem 13. August der Marienetta-Jirkowsky-Platz eingeweiht. Weil Politiker in dem kleinen Städtchen nach reiflicher Überlegung beschlossen, sich nicht zu beugen, obwohl sich ein Chor der Entrüstung über die Pläne erhoben hatte. Und obwohl die Lokalzeitung, ein Heimatforscher und die Linkspartei auf den Barrikaden standen. Und die Tante.
Einen Platz nach ihrer Nichte zu benennen, hatte die 71-jährige Bärbel Kultus aus Fürstenwalde im Frühjahr einem Reporter der "SUPERillu" erklärt, sei überflüssig und "geschmacklos". Es sei doch "kein Verdienst", an der Mauer erschossen worden zu sein. Der Stadtverwaltung in Hohen-Neuendorf schrieb sie, es sei "unverschämt und anmaßend", über die Geschichte zu recherchieren. Trotzdem habe man ihren Wunsch ignoriert, klagte Kultus in einem Interview: "So ist das eben bei Politikern, die sich profilieren wollen."
Sie spricht aus Erfahrung, denn auch das frühere SED-Mitglied Bärbel Kultus war einmal Kommunalpolitikerin. Davon erzählte Tante Bärbel den Journalisten allerdings nichts. Kein Wort auch davon, dass sie selbst seit 1970 beim Staatssicherheitsdienst der DDR (MfS) registriert war. "GMS Bärbel", die schon frühzeitig für die "sehr gute Durchführung einer operativ wichtigen Maßnahme" von ihrem Führungsoffizier beschenkt wurde, vertrat genau jene DDR, von der ihre Nichte am Ende die Nase gründlich voll hatte: "Sie ist ständig bestrebt die Beschlüsse von Partei u. Regierung durchzusetzen", lobte Bärbels Führungsoffizier.
Als sich Marienetta Anfang 1980 verliebte, herrschte zwischen ihren Eltern und Tante Bärbel Funkstille: Familienkrach. Erst als das junge Mädchen schon tot war, rührte sich die linientreue Tante wieder. Sie meldete sich im Büro von Feldwebel Dargel, dem verantwortlichen Mitarbeiter des MfS in ihrem Betrieb, und teilte pflichtgemäß mit, ihre Nichte sei bei einer "Grenzverletzung" tödlich verletzt worden. Trauer oder Bestürzung um den Verlust des jungen Mädchens waren aus der Meldung nicht zu ersehen. Eher die Sorge, selbst durch den leidigen Vorfall in ein schlechtes Licht zu geraten und sich deshalb vorsichtshalber zu distanzieren.
Marienetta war erst 17 Jahre alt, als sie sich in den 23-jährigen Peter verliebte. Der kam gut an bei den jungen Mädchen im Kreis Fürstenwalde: von sportlicher Statur, mit Schnurrbart und lockiger Mähne. Allerdings auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Der junge Mann war der Volkspolizei schon mehrfach aufgefallen. Mal wegen einer Prügelei, mal wegen eines Eigentumsdelikts. Schon als Teenager hatte man ihn wegen "Missachtung der Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens" für zwei Jahre weggesperrt. Peter war keiner, der sich gern unterordnete und als potentieller Schwiegersohn vermutlich nicht gerade der große Wurf. Tante Bärbel hielt ihn schlicht für einen "Asozialen".
So ähnlich dürften es auch Marienettas Eltern empfunden haben. Nachdem Peter Anfang Mai 1980 seine Frau und Tochter verließ und fortan mit Marienetta zusammen wohnte, hieß es: "Der nicht!" Doch das Liebespaar traf sich heimlich weiter, worauf das junge Mädchen an einem Sonntagnachmittag Besuch von der Spreenhagener Volkspolizei bekam und ernsthaft ermahnt wurde, den Kontakt zu Peter abzubrechen. Sollte sie zudem weiterhin die Arbeit in ihrem Lehrbetrieb schwänzen, könne sie mit zwei Jahren Gefängnis rechnen.
Für Peter kam es noch dicker. Er wurde von der Gemeinde Bad Saarow, Abteilung "Innere Angelegenheiten", aufgrund seines "negativen Lebenswandels" zur "kriminell gefährdeten Person" erklärt. Dazu gab es in der DDR eine gesetzliche Handhabe. Man erließ gleich mehrere Auflagen gegen den jungen Mann, um die unerwünschte Liebesbeziehung zu beenden. Peter durfte Marienetta für den Zeitraum von vier Monaten nicht mehr in seine Wohnung aufnehmen, seinen Wohnort ohne Genehmigung nicht verlassen, bestimmte Lokale nicht mehr betreten und hatte außerdem jeden Umgang mit Marienetta zu unterlassen. Er habe "ab sofort seine Lebensweise zu ändern", anderenfalls habe er damit zu rechnen, erneut "in Haft genommen" zu werden, teilte man ihm mit.
Falko Vogt erinnert sich genau an die damalige Zeit. Er war mit Marienetta und Peter befreundet. Vogt schmiedete damals auch den Fluchtplan, der Peter und ihm die Freiheit brachte und Marienetta auf tragische Weise das Leben kostete. Bis heute lässt ihn die Erinnerung daran nicht los. "Ich habe mir damals geschworen, ich räche das", sagt Vogt: "Und wenn ich mein ganzes Leben dafür arbeiten muss."
Marienetta und Peter wohnten in verschiedenen Gemeinden und konnten nur durch Briefe in Verbindung bleiben, erzählt Vogt. "Die beiden litten sehr darunter, dass sie sich monatelang nicht sehen durften." Marienetta habe gewusst, dass ihre eigene linientreue Familie für die ausweglose Situation mitverantwortlich war. Nach monatelanger Gängelei sei ihr klargeworden, dass es im Arbeiter- und Bauernstaat für eine Beziehung mit ihrem "Peterle" keine Zukunft gab. Marienetta und Peter wurden durch die Polizeistaatsmethoden in der DDR regelrecht in die Flucht getrieben.
"Marienetta war eine starke Frau", sagt Falko Vogt. "Sie wollte denen keine Chance geben, sie und ihren Peter auseinanderzubringen. Eines war ganz klar. Sie wollte mit ihm zusammen weg von hier, für immer." Doch Marienetta schaffte es nicht in den Westen, sie starb bei dem Versuch, die Mauer zu überwinden. Von dem jungen Mädchen gab es öffentlich lange Zeit nur ein einziges Passfoto.
Jetzt sind in der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU mehrere Fotografien und Dokumente von Marienetta Jirkowsky aufgetaucht, die bisher als verschwunden galten. Sie wurden von der Staatssicherheit nach deren Tod bei ihren Freundinnen und im Bekanntenkreis eingesammelt, weil man unter allen Umständen verhindern wollte, dass eine Fotografie von ihr in den Westen gelangt. Diese Bilder und Dokumente werden bei einestages erstmals gezeigt.
Im Herbst 1995 wurde vor dem Neuruppiner Landgericht ein Verfahren gegen zwei DDR-Grenzsoldaten eröffnet, die das junge Mädchen bei ihrem Fluchtversuch mit automatischen Waffen beschossen. Rückblickend meint Vogt, dass die damalige Richterin keinen großen Ehrgeiz entwickelt habe, um den Fall aufzuklären: "Für mich sah es so aus, dass die ganze Sache möglichst rasch vom Tisch sein sollte. Der ganze Prozess war eine Farce."
Vogt erinnert auch an einen Zwischenfall an der Berliner Mauer, der sich nur etwa vierzehn Tage vor dem Tod der jungen Frau ereignete. Damals erschoss ein 19-jähriger DDR-Grenzsoldat seinen Postenführer, bevor er sich in den Westen absetzte. Die Westberliner Staatsanwaltschaft schlug damals bewusst eine "harte Gangart" gegen Egon B. an und verurteilte diesen schließlich wegen Totschlags zu einer sechsjährigen Jugendstrafe. Ganz anders in Brandenburg. "Der Soldat, den man am Ende in Neuruppin verurteilte, bekam wegen 'Totschlag im minderschweren Fall' nur 15 Monate zur Bewährung", sagt Vogt und fragt: "War Mickis Leben weniger wert?"
Schlimmer aber noch, so Vogt, sei die Geschichte mit dem verschwundenen Grenzer. Dem Mann, der Marienetta mutmaßlich auf dem Gewissen hat. Dieser Grenzer gab aus geringer Entfernung zwei Einzelschüsse auf das an der Mauer hängende junge Mädchen ab und fügte ihr damit schwere innere Verletzungen zu. "Der war überhaupt nicht vor Gericht", sagt Vogt: "Die Richterin sagte, er sei schon tot." Davon aber weiß man in der Staatsanwaltschaft Neuruppin nichts. Dort heißt es auf Nachfrage, es gebe in den Gerichtsakten keine Hinweise darauf, dass der Postenführer Gerd J. bereits verstorben sei, wie es seinerzeit in verschiedenen Zeitungen gemeldet wurde.
Inka Gossmann-Reetz hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Schicksal von Marienetta Jirkowsky beschäftigt. Sie ging in Spreenhagen auf Spurensuche und setzte am Ende die Benennung eines Platzes nach dem jungen Mädchen durch, obwohl Tante Bärbel wochenlang Sturm dagegen lief. Doch Genugtuung verspürt die junge SPD-Politikerin nicht, als sie am 13. August in Hohen Neuendorf den Marienetta-Jirkowsky-Platz mit einer Rede einweiht. "Ein Menschenleben wurde sinnlos ausgelöscht", sagt sie. "Das einzige 'Verbrechen', das dieses Mädchen beging, war, dass sie sich in den 'falschen' Mann verliebte."
Eine kleine Begebenheit macht Hoffnung, dass die tiefen Gräben der Vergangenheit vielleicht doch einmal überwunden werden können. Im November 2004 erhielt Marienettas Vater im Krankenhaus Fürstenwalde Besuch von einer Berliner Kulturwissenschaftlerin. Ihr sagte er, dass er hoffe, dass seine Familie die Aufarbeitung der Geschichte seiner Tochter unterstützen werde. Wenige Tage später starb Marienettas Vater. Auf seiner Beerdigung in Spreenhagen tauchte auch eine der anderen Tanten von Marienetta auf. "Sie müssen das aufschreiben", sagte sie: "Wissen Sie, das war Mord vom Mielke. Das hat die ganze Familie kaputtgemacht."



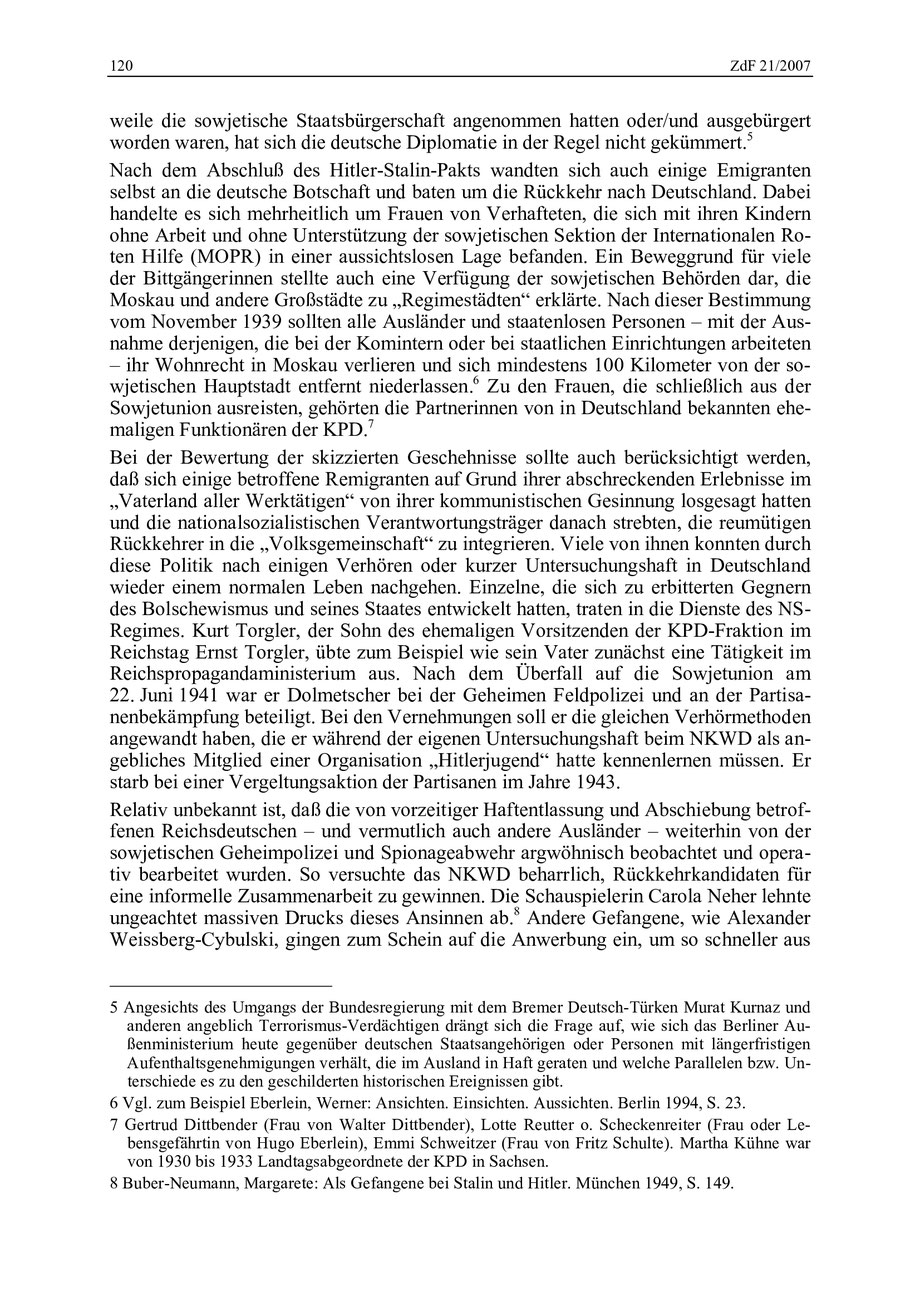

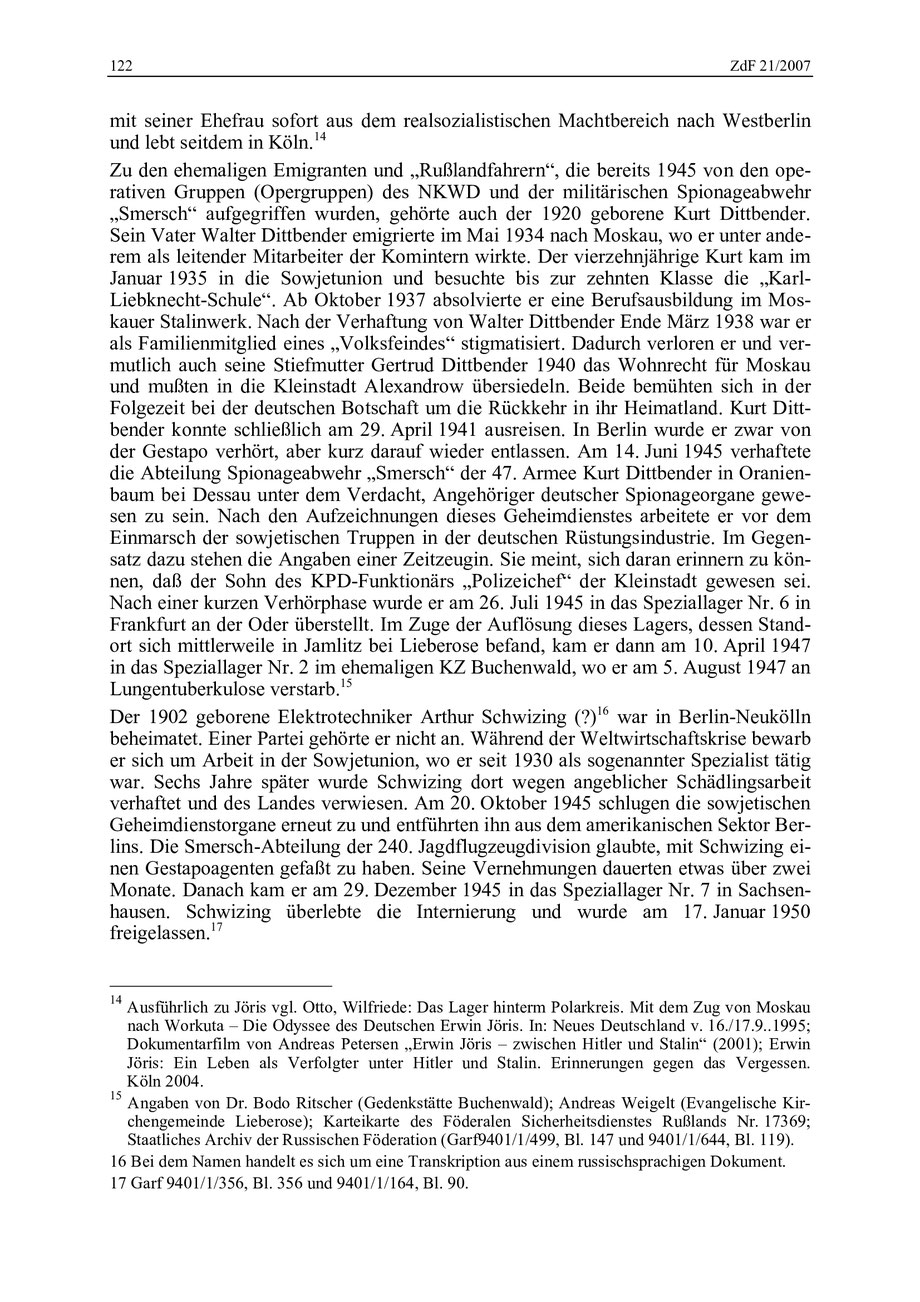

Ostdeutsche im Gulag: Ein oft vergessenes Kapitel DDR-Geschichte
Sie sind großteils vergessen: Ostdeutsche wie Johannes Krikowski wurden in sowjetische Arbeitslager verschleppt. Sein Sohn betreibt Aufarbeitung. Ein Treffen. Lenja Stratmann 29.10.2022
In der DDR durftest du nicht darüber reden, im Westen interessiert es keinen.“ Das sagt Stefan Krikowski, während er von der Geschichte seines 2007 verstorbenen Vaters erzählt. Johannes Krikowski wurde 1952 als junger Student der Zahnmedizin zu 25 Jahren Haft im Arbeitslager Workuta verurteilt. Die russische Stadt liegt im Ural, 100 Kilometer über dem nördlichen Polarkreis.
Sein Vergehen? Der 21-Jährige hatte freie und geheime Studentenratswahlen an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät gefordert und war zudem ein bekennender Christ. „Er wurde im Studentenwohnheim gefragt: Was macht die Bibel auf deinem Schreibtisch? Da müssen doch die blauen Bände liegen“, erzählt sein Sohn. „Mein Vater war zunächst in der FDJ, er hoffte auf einen Neuanfang nach dem katastrophalen Nationalsozialismus. Aber als KPD und SPD 1946 zur SED zwangsvereinigt wurden, merkte er: Hier wird eine neue Diktatur errichtet.“
Was Krikowski widerfuhr, war kein Einzelschicksal. Knapp 40.000 Deutsche wurden zwischen 1945 bis 1955 vor sowjetischen Militärtribunalen verurteilt. Das ehemalige KZ Sachsenhausen in Oranienburg diente für 16.000 SMT-Verurteilte als Haftlager. Viele wurden in nordsibirische Gulags deportiert, manche Schätzungen gehen von bis zu 25.000 Opfern aus. „Aber wer weiß in Deutschland schon davon?“, fragt Stefan Krikowski. Er dokumentiert heute Geschichten Deutscher, die wie sein Vater als politische Gefangene im Arbeitslager Workuta waren. Dafür hat er 2020 die Bundesverdienstmedaille erhalten. Doch das gesellschaftliche Bewusstsein über Verbrechen in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone fehlt. Und die jüngsten lebenden Zeitzeugen werden nun 90 Jahre alt.
Verrat, Stasi-Haft, Deportation nach Sibirien
Die verhängnisvolle Geschichte seines Vaters beginnt so: In der Nacht zum 1. November 1951 um 2 Uhr wurde Johannes Krikowski von vier bewaffneten Stasi-Männern im Studentenwohnheim verhaftet. Wenige Tage zuvor hat ein Kommilitone, Mitglied der FDJ, Krikowskis Aushang für die Junge Gemeinde am schwarzen Brett der Universität abgerissen. Dass er ihn bei der Stasi angeschwärzt hat, liegt nahe.
Es folgten eine Woche Stasi-Haft in Greifswald, dann wird Krikowski dem NKWD in Schwerin übergeben. Das sogenannte Volkskommissariat war für Innere Angelegenheiten in der Sowjetunion verantwortlich und fungierte als Geheimdienst. Die Verhörmethoden im Gefängnis am Demmlerplatz, das zuvor von Nazis genutzt wurde, waren brutal: Schlafentzug, Schläge, Folter.
„Du durftest nie sitzen, dann bekamst du mit dem Lineal eins drüber. Meinen Zahn haben sie mir ausgeschlagen, mit einem Schlüsselbund. Sie legten die Pistole vor sich, holten die Kugel raus, klopften sie mir gegen den Kopf […]. Dann sagte er: Wollen du leben?, und ich habe immer Hunger gehabt“, erinnerte sich Johannes Krikowski 2007 im Interview mit Anne Drescher. Sie ist seit 2013 Mecklenburg-Vorpommerns Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Einzelhaft ging monatelang, man hatte weder Einblick in den Haftbeschluss noch Recht auf einen Anwalt.
Ich habe dann angefangen zu memorieren, den 23. Psalm aufzusagen, oder irgendein Gedicht. Dann verlassen einen auch die Gedanken
Johannes Krikowski, 2007
Am 29. Januar 1952 unterschrieb er ein Geständnis über seine „verbrecherische Verbindungsaufnahme“ mit westlichen Geheimdiensten. Diese hatte nie stattgefunden. „Man war gebrochen. Du warst schlicht und einfach zerbrochen“, erinnerte er sich wenige Monate vor seinem Tod.
Im März 1952 fiel im Gruppenprozess mit acht Angeklagten, darunter Erika Kunert, eine Freundin Krikowskis, das Urteil: 25 Jahre Haft im „Arbeitsbesserungslager“ Workuta. Rechtsgrundlage dafür waren Artikel 58, Absatz 6 und 10 des Strafgesetzbuches der UdSSR: Antisowjetische Propaganda und Spionage. Kunert wurde das Gleiche zur Last gelegt, sie wurde laut Haftbeschluss „als Agentin entlarvt, welche für den französischen Geheimdienst Spionagematerial lieferte“. Sie erhielt, wie knapp tausend andere Deutsche von 1950 bis 1953, ein Todesurteil. Am 12. Juni 1952 wurde sie nachts im Butyrka-Gefängnis in Moskau erschossen.
Die Familien wurden im Dunkeln gelassen
Eltern wussten oft jahrelang nicht, warum ihre Kinder verhaftet und wohin sie gebracht wurden. Ihre Verzweiflung ist bei Stefan Krikowski dokumentiert, in Form von unterwürfigen Bittbriefen an hohe Stellen. Vom Lehrer Rudolf Bockel gibt es aus den Jahren 1950 bis 1953 weit über hundert Briefe. Sein Sohn Dietmar, geboren 1930, wurde im Alter von 19 Jahren vor seinen Augen von der Stasi verhaftet und nach Workuta verschleppt. Bockel wandte sich an hohe SED-Parteifunktionäre wie Walter Ulbricht und den DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck.
„Wir wissen nach 16 Monaten noch nicht, wo sich mein Junge befindet und welches sein Schicksal ist!“, schrieb Bockel 1951 an den DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Die meisten Briefe blieben unbeantwortet. Auch in der Bundesrepublik bat Bockel um Hilfe, schrieb an den Bundeskanzler Konrad Adenauer.
Zwangsarbeit bei bis zu minus sechzig Grad
Sein Sohn befand sich währenddessen mehrere tausend Kilometer entfernt in Nordsibirien. Die russische Stadt Workuta liegt 2300 Kilometer von Moskau entfernt, in der Tundra. Bis heute führen dahin keine Straßen, sondern nur von Häftlingen gebaute Schienen. „Die Region Workuta ist übersäht mit Straflagern, wie ein Sternenhimmel“, sagt Stefan Krikowski, der selbst vor Ort war.
In Workuta wurde vor allem Steinkohle abgebaut, in Höchstzeiten waren dort circa 70.000 Männer und Frauen verschiedener Nationalitäten inhaftiert: politische Gefangene, Kriegsgefangene und Kriminelle. Etwa 250.000 Menschen verloren in Workuta ihr Leben.
In einer Baracke mit zwei- oder dreistöckigen Betten schliefen bis zu 150 Menschen, Sanitäranlagen gab es nicht. Gearbeitet wurde täglich um die zehn Stunden, der Tag begann um sechs Uhr. Die Männer bauten Steinkohle ab, die Frauen arbeiteten in der Ziegelei oder im Gleisbau. Allein der kilometerlange Weg zum Schacht war „qualvoll, durch die eisige Polarnacht mit extremen Kältegraden und oft gewaltigen Schneestürmen“, wie der Zeitzeuge Hans Günter Aurich in seinem Privatarchiv beschreibt. Nahrung gab es im Lager nie genug, die medizinische Betreuung war katastrophal.
Lichtblicke waren Pakete des Deutschen Roten Kreuzes, der Arbeiterwohlfahrt und der Kirche. Mit Kaffee und Zigaretten aus dem Westen wurden die Wärter bestochen: Marlboro statt russischem Machorka-Tabak wurden gegen einige Tage im Krankenlager eingetauscht. Fluchtversuche waren hoffnungslos. Selbst im Sommer bei 20 Grad hätte man hunderte Kilometer in der Steppe der Komi-Republik überleben müssen und war wilden Tieren ausgesetzt. Auch hatten die Lageraufseher einen Pakt mit den Nenzen, einem indigenen Volk Sibiriens, geschlossen: Sie brachten gefundene Häftlinge für Gegenleistungen zurück.
Leicht verbesserte Haftbedingungen nach Stalins Tod 1953
Der Griff im Arbeitslager lockerte sich ab 1953 leicht. Von da an wurden auch keine DDR-Bürger mehr nach Workuta verschleppt. Stalin starb im März 1953, in der DDR entluden sich die Spannungen am 17. Juni in einem Volksaufstand. Knapp eine Woche später wurde Lawrenti Beria, der Geheimdienstchef der UdSSR, entmachtet und verhaftet. Die Nachricht verbreitete sich bis nach Workuta und gab Anlass zu einem Streik, der knapp zehn Tage lang andauerte. 481 Gefangene starben. Ihre Forderungen waren menschlichere Arbeitsbedingungen und eine Überprüfung ihrer Hafturteile.
Unter Nikita Chruschtschow wurde die Arbeitszeit im Lager auf acht Stunden täglich verkürzt, es gab etwas mehr Nahrung, Gefangene durften Briefe schreiben. Als Absender wurde statt Workuta zwar nur ein Postcode angegeben. Aber immerhin wussten die Eltern nun: Unser Kind lebt.
Befreiung der Deutschen durch Bundeskanzler Adenauer
Erst zwei Jahre später wurden die Deutschen vom Martyrium der sowjetischen Arbeitslagern befreit. „48 Kilo hat mein Vater gewogen, als er nach Berlin zurückkam“, sagt Krikowski. Workuta war zwar bis in die 60er-Jahre hinein in Betrieb. Im Jahr 1955 durften jedoch deutsche Kriegsgefangene sowie die, die aus politischen Gründen in den vergangenen zehn Jahren nach Sibirien geschickt worden waren, nach Hause zurückkehren. Grund dafür war die Ostpolitik Adenauers, der diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufbauen wollte. Die sah man als unabdingbar an, um eine deutsche Wiedervereinigung zu ermöglichen. „Adenauer hat die Menschen förmlich freigepresst“, so Krikowski.
In einem Antwortschreiben des Bundeskanzleramtes an Rudolf Bockel aus dem September 1955, nach Adenauers Moskaureise, hieß es: „Was die Frage der in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deutschen betrifft […], so wurde vereinbart, dass wir der Sowjetregierung eine Liste der Personen mit genauen Angaben geben werden. Die Sowjetregierung wird feststellen, wo diese Menschen sind.“
Die Menschen kehrten gebrochen zurück
Doch wer einmal im Lager war, den ließ es sein Leben lang nicht mehr los. 1955 kam Johannes Krikowski nach Berlin zurück. Er begann ein Theologiestudium und wurde Lehrer. Sein Sohn beschreibt ihn als „seelisch und körperlich gebrochen“. Lebenslang habe Krikowski Schlafstörungen gehabt und Medikamente nehmen müssen. Auch ein strenger Reinlichkeitswahn habe ihn für immer begleitet. „Er musste selbst sehen, wie er überleben konnte. Frau, Kinder, Beruf – vielleicht kam das alles zu früh. Ich fand das natürlich belastend, einen Vater zu haben, der zerstört ist“, sagt Stefan Krikowski. Was heute „posttraumatische Belastungsstörung“ genannt wird, war damals nicht ausreichend erforscht oder anerkannt. Dabei hatte es Auswirkungen auf ganze Familien.
„Was heißt es für Frauen, mit so einem Mann verheiratet zu sein?“, fragt Krikowski. „Das sind ja keine Helden, keine besseren Menschen, die aus Workuta zurückkommen. Im Gegenteil.“ Was hinter dem Trauma von Weltkriegsüberlebenden zurückstand, nannte man Haftfolgeschäden – sofern man überhaupt darüber sprach.
Bis heute fehlt das gesellschaftliche Bewusstsein
Das Verschweigen hat letztlich dazu geführt, dass viele Deutsche von diesen Verbrechen in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR gar nichts wissen. Von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur heißt es auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Über die Urteile der sowjetischen Militärtribunale wird bereits längere Zeit geforscht und publiziert auch mit unserer Förderung.“ Insbesondere die Gedenkstätten zu sowjetischen Speziallagern beschäftigten sich damit. Dennoch müsse öffentlich „immer wieder und weiter auf dieses Thema hingewiesen werden“. Laut Krikowski liege das auch an der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Unrechtsherrschaften des 20. Jahrhunderts und dem starren Fokus auf die NS-Geschichte. „Natürlich will ich nationalsozialistische nicht mit kommunistischen Verbrechen gleichsetzen“, sagt er.
Dennoch würde er sich wünschen, dass nicht nur die Geschwister Scholl, sondern auch Namen wie Arno Esch und Herbert Belter der deutschen Bevölkerung ein Begriff wären. Sie hatten als junge Studenten mit Flugblättern gewaltfreien Widerstand gegen die SED-Diktatur geleistet und wurden 1951 in Moskau hingerichtet.
Darüber zu sprechen, was viel zu lange verschwiegen wurde – das ist eine Aufgabe, der Stefan Krikowski sich verpflichtet hat. Die Biografien dokumentiert er auch online, auf www.workuta.de. „Wenn man das nicht mehr macht, ist es vergessen. Es ist wie ein Auftrag, der mir gegeben wurde“, sagt er. Auf die Frage, wie er diese intensive Auseinandersetzung mit dem Leidensweg seines Vaters ertrage, antwortet Krikowski: „Natürlich wühlt das auf. Aber es nutzt nichts, man muss sich stellen. Es ist ein schweres Erbe, aber das bin ich meinem Vater schuldig. Er hat ganz andere Dinge durchgemacht.“
Gisela Gneist (1930–2007) im Fokus erinnerungspolitischer Auseinandersetzungen
21-12-01_Ney_Thomas_-_Gneist-Artikel_in_der_ZdF_Ausgabe_48_Jan._2022.pdf (gedenkbibliothek.de)
Straße nach Nazi-Jungmädel benannt
Gutachten belegt: Speziallagerhäftling Gisela Gneist als Namensgeberin in Oranienburg ungeeignet
Andreas Fritsche, Oranienburg 30.11.2021
In Stadtplänen ist die Gisela-Gneist-Straße von Oranienburg bereits verzeichnet. Doch vorerst gibt es sie fast nur auf dem Papier. Während der nördliche Teil des Neubaugebiets Aderluch bereits fertiggestellt und von den Bewohnern bezogen ist, dreht sich im südlichen Teil noch der Baukran neben einem Rohbau und ein Bagger steht zwischen riesigen Sandhaufen. Auf dem Gelände befand sich von 1942 bis 1945 das Außenkommando »Zeppelin« des nahen Konzentrationslagers Sachsenhausen. Hunderte Häftlinge, vor allem osteuropäische Jugendliche, mussten hier in der Rüstungsindustrie schuften.
»Personen, nach denen Straßen in einem solchen Gebiet benannt werden, müssen gerade hinsichtlich ihrer Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur und ihren Verbrechen über jeden Zweifel erhaben sein«, findet Axel Drecoll, Direktor der Stiftung brandenburgische Gedenkstätten. Bei Gisela Gneist ist das nach seiner Überzeugung nicht der Fall. Ihn bestätigt jetzt ein zehnseitiges Gutachten des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Die Autoren Frank Bajohr und Hermann Wentker stellten es am Montag vor.
Gisela Gneist saß von 1946 bis 1950 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen, das die Baracken des befreiten Konzentrationslagers benutzte. Prinzipiell sei nichts dagegen einzuwenden, wenn in Oranienburg Straßen nach Häftlingen des Speziallagers benannt werden, versichert Stiftungsdirektor Drecoll. »Die sowjetischen Speziallager waren Orte von Unmenschlichkeit, Rechtlosigkeit und Gewalt. Zu unserer demokratischen Erinnerungskultur gehört selbstverständlich, an das Leid der Speziallagerinternierten, zu denen Gisela Gneist gehörte, zu erinnern.«
Aber der Ort sei der falsche. Das KZ-Außenkommando »Zeppelin« habe mit dem sowjetischen Speziallager nichts zu tun gehabt, erinnert Drecoll. Und auch die Person sei die falsche. Schließlich habe sich Gisela Gneist offensichtlich komplett geweigert, differenziert zu betrachten, dass im sowjetischen Lager auch Nazi-Kriegsverbrecher und andere Belastete gesessen haben. Außerdem habe Gneist Kontakte in die rechte und rechtsextreme Szene nicht gescheut.
1940 war Gisela Gneist - damals hieß sie noch Gisela Dohrmann - in den faschistischen Bund Deutscher Mädel (BDM) gekommen und 1942, mit zwölf Jahren, Jungmädelführerin geworden. Sie hat ihre Zeit dort als Idylle verklärt, wie Gutachter Wentker erläutert. Ihr Vater war früh in die NSDAP eingetreten, wahrscheinlich schon vor 1933. Nach Kriegsende betätigte sich die Tochter in ihrer Heimatstadt Wittenberge in einer antisowjetischen Gruppe, die eine hektografierte Zeitschrift mit dem bezeichnenden Titel »Germanische Freiheit« herausbrachte.
Die Gruppe, die sich Waffen beschaffen wollte, flog auf. Da den Gutachtern die sowjetischen Ermittlungsakten nicht zugänglich waren, in denen sich vielleicht Exemplare der Zeitschrift erhalten haben, konnten sie nicht nachprüfen, ob sich die Gruppe »in der Ideenwelt des nationalsozialistischen Antibolschewismus bewegte«, wie Wentker sagt. Zu vermuten ist es allerdings. Dies alles ließe sich noch als Jugendsünde entschuldigen. Andere, wie der Schriftsteller Erik Neutsch, waren nach Kriegsende auch noch von der Naziideologie verblendet und wurden eingesperrt, haben sich dann aber klar distanziert. Dies ist bei Gisela Gneist so nicht zu erkennen. Sie ging nach ihrer Freilassung in den Westen und wurde 1995 Vorsitzende der »Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945-1950 e.V.«, was sie bis zu ihrem Tod 2007 blieb.
Dem früheren Stiftungsdirektor Günter Morsch warf sie vor, dieser werde »keine Gelegenheit auslassen, um sich gegenüber dem Zentralrat der Juden und jüdischen Opferverbänden ins rechte Licht zu setzen, um sich deren Wohlwollen zu erkaufen«. Über einstige deutsche KZ-Häftlinge sagte sie, das seien vor allem »Berufsverbrecher, Asoziale und Indifferente« gewesen. 2005 unterschrieb sie einen revisionistischen Aufruf zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, veranlasst von dem rechten Verleger Götz Kubitschek. Im selben Jahr bat sie den ins rechte Lager abgedrifteten Journalisten Ulrich Schacht, in Sachsenhausen eine Ansprache zu halten. Schacht nahm die Einladung an und polemisierte gegen die bundesdeutsche Erinnerungskultur, wie Gutachter Bajohr erklärt. Schacht bescheinigte Außenminister Josef Fischer (Grüne) einen »sadistischen Charakter«, weil dieser das Gedenken an Auschwitz als Teil der Staatsräson bezeichnet hatte. Einen Aufruf gegen den Ausschluss der rechten Wochenzeitung »Junge Freiheit« von der Leipziger Buchmesse unterzeichnete Gisela Gneist ebenfalls.
Zu den Entgleisungen ihrer Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen gehörte 1996 der Plan einer Gedenkfeier für den Psychiater Hans Heinze (1895-1983). Der hatte im Speziallager gesessen und Insassen gepflegt. Heinze war aber von 1938 bis 1945 federführend an der sogenannten Euthanasie beteiligt. Unter seiner Leitung sind allein in der Klinik Brandenburg-Görden 1264 kranke Kinder ermordet worden.
Die Gedenkstätten-Stiftung und das Internationale Sachsenhausen-Komitee hatten vorher gewarnt. Trotzdem beschlossen die Stadtverordneten 2020, eine von acht neuen Straßen im Wohngebiet Aderluch nach Gisela Gneist zu benennen. Die Gisela-Gneist-Straße bildet zwei Kreuzungen ausgerechnet mit der Rosa-Broghammer-Straße. Broghammer litt im KZ, weil sie ein Kind mit einem französischen Kriegsgefangenen hatte. Im Sommer 1945 starb sie an den Folgen der Haft.
Die Linke konnte die Benennung seinerzeit nicht verhindern. Fraktionschef Ralph Bujok befürchtet, dass es auch jetzt keine Mehrheit für die Rücknahme des Beschlusses geben wird. Er hat Verständnis für die Opfer des Stalinismus. Sein eigener Schwiegervater war nach dem Krieg im Speziallager eingesperrt - »unschuldig«, wie Bujok betont. Er ist dafür, andere Straßen nach anderen Häftlingen des Speziallagers zu benennen.
Das „Neue Deutschland“ und die Sudel-Medien kamen wegen der Straßenbenennung in Oranienburg kaum zur Ruhe...
Wegen sog. „Volksverhetzung“ stand ich am 15.5.2023 vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die Gedenkstätte Sachsenhausen hatte gegen mich Anzeige erstattet, weil ich das Heft „Sachsenhausen-Workuta“ von Gerhart Schirmer hatte ins Englische übersetzen lassen. Als Zeuge war Dr. Enrico Heitzer von der Gedenkstätte Sachsenhausen geladen.
Dieser „DDR“-Doktor wirft mir in seiner Anzeige vor, ich wäre mit Gisela Gneist „befreundet“ gewesen! Soll ich etwa mit den SED-Betonköpfen „befreundet“ sein?
Das erinnert mich an den STASI-Hauptmann Joachim Richter im Zuchthaus Bautzen 1968, der in einer Einschätzung über mich schrieb, ich würde mich zu den „negativen Strafgefangenen“ hingezogen fühlen. In den obigen Artikeln werden Gisela Gneist ihren Eltern vorgeworfen!
Will mir der „DDR“-Doktor Heitzer etwa vorwerfen, daß mein Vater 1944 Fahnenflucht beging?

Foto: Märkische Oderzeitung

Gisela Gneist besuchte mich mehrmals an der Gedenkstätte „Weiße Kreuze“.
Dr. Christian Sachse vom Dachverband UOKG Auszug:
...Das Konstrukt wird für die Zeit nach 1990 mit ähnlicher Argumentationsstruktur wiederholt. Der Gutachter lässt keine Gelegenheit aus, Frau Gneist in ein zwielichtiges Licht zu rücken. Straftaten oder aufsehenerregende Äußerungen zugunsten rechtsradikaler Positionen können ihr offenbar nicht nachgewiesen werden. Also werden gesinnungsethische Bedenken nach der Maxime gestreut „Sage mir, mit wem Du umgehst, und ich sage Dir, wer Du bist.“ Dabei lässt der Verfasser seiner Phantasie freien Lauf. Die hervorragenden Kontakte von Frau Gneist zur Stiftung Aufarbeitung, zu anderen Lagerinitiativen, zur UOKG und Historikern passen nicht ins negative Bild und werden verschwiegen. Es wäre sicher möglich, aber sehr eintönig, die sich wiederholenden Verdächtigungen im Einzelnen zu beschreiben. Das kann der Leser, die Leserin, bei Interesse, sicher eigenständig leisten...
Häftlingsdeals mit der DDRMenschen gegen Maisladungen
40.000 D-Mark für die Freiheit: Von 1963 bis 1989 verkaufte das SED-Regime fast 34.000 politische Gefangene an die Bundesregierung. Erst gegen Geld, später gegen Güter. Mitinitiator Ludwig A. Rehlinger erinnert sich an die geheimen Deals - und verrät, warum er die Geretteten nicht treffen wollte. Von Katja Iken, 24.10.2011
Gerade kürzlich, da holten ihn die Emotionen wieder ein. Obwohl sich Ludwig A. Rehlinger ein Leben lang davor zu schützen versucht hatte. "Ich fuhr mit dem Rad hier draußen durch den Brandenburger Wald", sagt der Mann mit dem weißen Haar und zeigt aus dem Fenster seines eingeschossigen Rotklinkerhäuschens. Plötzlich rief ihm ein Ehepaar hinterher. Rehlinger stieg ab und stand vor einem älteren Herrn. "Der drückte mich so fest an die Brust, dass mir schier die Luft wegblieb", erinnert sich der 84-Jährige und lächelt. Dann habe er gesagt: "Herr Rehlinger, Sie haben mir das Leben gerettet!" Der ältere Herr war Harry Seidel, ein ehemaliger DDR-Radrenn-Profi. Kurz nach dem Mauerbau 1961 war der ehemalige Vorzeigesportler in den Westen geflohen, im Jahr darauf erwischte ihn die Staatssicherheit beim Versuch, ehemalige Mitbürger durch einen Tunnel in die Freiheit zu schleusen. Seidel bekam lebenslänglich - und Rehlinger holte ihn 1966 aus dem DDR-Gefängnis raus. Gegen Schiffsladungen mit Mais. "Freikauf" lautet der Terminus für eines der geheimsten und bis heute umstrittensten aller deutsch-deutschen Geschäfte. Ausgerechnet an den Klassenfeind im Westen verkaufte die DDR ab 1963 ihre politischen Häftlinge. Wie Schachfiguren wurden die Menschen von der einen auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs verschoben. Rehlinger, Justizsenator a.D. und einstiger Behördenchef, gehört zu den Begründern des historischen Deals. "Ohne Zögern und Zaudern" gegen das Unrecht.
Der Jurist mit dem wachen Blick, dessen Erinnerungen an die geheimen Deals jetzt als Buch beim Mitteldeutschen Verlag neu aufgelegt wurden, ist der letzte noch lebende Zeitzeuge, der den Freikauf von bundesdeutscher Seite aus mit eingefädelt hat. Wobei Rehlinger das Wort "Freikauf" nicht besonders gern mag. Lieber spricht er von den "besonderen humanitären Bemühungen der Bundesrepublik". Das ist neutraler, nicht so gefühlig. Und einen kühlen Kopf, den musste Rehlinger bewahren als diskreter westdeutscher Unterhändler in einer so heiklen Mission wie dem Tausch von Menschen gegen Güter.
Angetrieben von dem Wunsch, eine lukrative Geldquelle zu erschließen und gleichzeitig das eigene, ziemlich ramponierte Ansehen auf dem internationalen Polit-Parkett aufzupolieren, bot die DDR der BRD im Jahr 1962 erstmals an, politische Häftlinge zu verkaufen. Jürgen Stange, ein West-Berliner Rechtsanwalt, der als Inhaber eines bundesdeutschen Ausweises in beiden Teilen der Stadt ein- und ausging und einen engen Kontakt zu Ost-Berliner Anwälten pflegte, übermittelte diese brisante Nachricht an den Westen. "Ich war sofort begeistert", sagt Rehlinger, und beugt sich in seinem blassblauen, von Bücherstapeln und Tageszeitungen umgebenen Sessel vor. Als persönlicher Referent des Ministers für gesamtdeutsche Fragen, Rainer Barzel, nahm Rehlinger die geheimen Verhandlungen mit der DDR-Seite auf. Motiviert hat ihn dabei das Bedürfnis, "ohne Zögern und Zaudern", wie er sagt, "gegen das Unrecht anzukämpfen". Denn das Unrecht, das hat Rehlinger am eigenen Leib erfahren. Grauenvolles Schicksalsspiel
Als Teenager bekam er von den Nationalsozialisten einen Stahlhelm auf den Kopf gesetzt und wurde an die Kanone gestellt. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, als er an der Berliner Humboldt-Universität Jura studierte, erlebte Rehlinger eine neue Variante staatlicher Willkür: Kommilitonen, die sich politisch nicht im Sinn der gerade gegründeten SED engagiert hatten, verschwanden spurlos, wurden festgenommen, weggesperrt.
"Wir hatten die moralische Pflicht, diesen Menschen zu helfen", sagt Rehlinger. Im Verlauf der geheimen Verhandlungen, die er mit der DDR-Seite führte, oblag ihm eine besonders schwierige Aufgabe: Rehlinger musste entscheiden, welche der eingesperrten Häftlinge freikommen sollten. "Ein qualvoller Prozess", sagt er. Wochenlang studierte Rehlinger die Akten der damals rund 12.000 in Ost-Gefängnissen einsitzenden DDR-Bürger, immer wieder strich er die Liste zusammen, spielte Schicksal - versuchte, gerecht zu sein, ohne allen gerecht werden zu können. "Hinter jeder Akte steckte ein Mensch, grauenvoll war das", sagt Rehlinger und klammert sich an die Papiere, die auf seinem Schoß liegen. Nachdem die DDR den Westen beim ersten Deal zunächst mit 1000 Häftlingen geködert hatte, reduzierte sie ihr Angebot sukzessive: zunächst auf 500, dann auf 100, dann auf zehn. Bis schließlich nur noch acht übrigblieben.
320.000 D-Mark in braunem Packpapier
Blieb die unangenehme Frage der Gegenleistung für diese acht Menschen: Wie viel war die Bundesregierung bereit, für jeden politischen Häftling zu zahlen - wie bemisst sich der Wert eines Menschen? Auch diese Verhandlungen führte Rehlinger als BRD-Unterhändler mit der DDR- Seite, zumeist mit dem Ost-Berliner Anwalt Wolfgang Vogel. "Ich versuchte natürlich, so niedrig wie möglich reinzugehen", erinnert er sich. Am Ende eines zähen Ringens habe man sich auf 40.000 D-Mark pro Häftling geeinigt. Macht für acht Häftlinge 320.000 D-Mark - zu übergeben in bar.
Was 1963, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, nicht gerade einfach war: Bundesregierung und DDR unterhielten damals keinerlei offiziellen Beziehungen, ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein offizieller Gesandter Bonns einfach so mit Bargeld in der Tasche über die Grenze marschierte. Damit der Freikauf nicht aufflog, weder Zöllner noch Medien Wind von dem hochgeheimen Geschäft bekamen, fuhr Rehlinger mit Anwalt Jürgen Stange zum Lehrter Stadtbahnhof.
Dort setzte er Stange mitsamt dem Geld in die S-Bahn, die direkt über die Sektorengrenze nach Ost-Berlin fuhr. "So trickste ich die Grenzkontrollen aus und konnte gleichzeitig sichergehen, dass das Geld zuverlässig in der DDR landet", sagt Rehlinger.
"Dass einer noch an mich gedacht hat"
Im Herbst 1963 kamen die ersten acht Häftlinge frei. Zu den DDR-Bürgern, die von Rechtsanwalt Jürgen Stange einzeln in Ost-Berlin abgeholt und per S-Bahn in die westliche Freiheit geleitet wurden, gehört auch Kurt Schulz: ein Tischler, der nach dem Zweiten Weltkrieg vom sowjetischen Militärtribunal ohne ersichtlichen Grund zunächst zum Tode und dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Schulz hatte in der DDR bereits mehr als zehn Jahre im Gefängnis gesessen.
Als er im Anwaltsbüro in Berlin-Charlottenburg angekommen war, erlitt Schulz einen Schock. "Dass einer an mich gedacht hat", sagte er und glitt bewusstlos vom Stuhl. Unterhändler Rehlinger war nicht zugegen - absichtlich nicht. Weil er Angst hatte vor zu vielen Emotionen. "Als meine Mitarbeiter mich anriefen und mir von Schulz' Zusammenbruch erzählten, erlitt ich einen Heulkrampf, das muss ich zugeben", sagt Rehlinger sichtlich bewegt.
Doch schnell kontrolliert er sich wieder und erzählt, wie aus der zunächst einmaligen Freikaufsaktion von 1963 eine dauerhafte Institution wurde: Ein Jahr, nachdem Tischler Schulz und die anderen sieben Häftlinge freigekommen waren, erneuerte die DDR ihr Angebot, politische Häftlinge gegen Geld in den Westen zu entlassen. Die Verantwortlichen in der BRD willigten ein, und so legte Rehlinger ein weiteres Mal eine Häftlings-Wunschliste vor, handelte den Preis aus, organisierte das Procedere. Jahr für Jahr wiederholte sich das Ritual und entließ die DDR einen Teil ihrer politischen Häftlinge in den Westen - bis zur Wende sollten daraus 33.755 Menschen werden.
Wunderbus mit doppelten Nummernschildern
Mit Bussen, die im Osten bald den Beinamen Wunderbus erhielten, wurden die freigekauften Häftlinge an die Grenze gebracht und hier, auf unauffälligen Parkplätzen oder Waldlichtungen, an den Westen übergeben, bevor sie ins Aufnahmelager Gießen gelangten. Später holte die Bundesregierung die Menschen direkt in der Haftanstalt Karl-Marx-Stadt ab.
Um im Osten nicht aufzufallen, verfiel der hessische Busunternehmer Arthur Reichert auf die Idee der doppelten Nummernschilder, wie sich Rehlinger erinnert: Sobald der Bus die Grenze passiert hatte, drehte der Fahrer per Knopf am Armaturenbrett die Nummernschilder: Aus dem Westkennzeichen HU-X 3 wurde das DDR-Nummernschild IA-48-32 - auf dem Rückweg klappte wieder das BRD-Kennzeichen runter.
Mitgefahren in einem der Wunderbusse ist Rehlinger nicht ein einziges Mal: Der Behördenchef untersagte sich persönliche Begegnungen mit den Gefangenen, die er freikaufte. "Ich wollte mich da emotional so weit wie möglich raushalten", sagt Rehlinger.
Waren auf dem Weltmarkt versilbert
Unmoralisch fand der Jurist ihn nie, den Kommerz mit den DDR-Häftlingen. "Wer verstieß denn gegen die Moral - der, der Menschen gegen Geld freiließ, oder der, der bezahlte, um politisch Verfolgten zu helfen?", fragt Rehlinger. Zumal die BRD nach 1963 keine Koffer mit Bargeld mehr in den Osten schleuste, sondern die Gegenleistung in Waren erbrachte, um den notorischen Mangel in der DDR zu lindern: Wurden die Häftlinge 1964 vor allem mit Südfrüchten bezahlt, waren es danach Güter wie Getreide, Erdöl, Industriediamanten, Kupfer.
"Wir wollten damit den Brüdern und Schwestern drüben etwas Gutes tun", sagt Rehlinger, der in den sechziger und achtziger Jahren bis hin zur Wende nicht nur den Freikauf organisierte, sondern auch zahlreiche Agentenaustausche zwischen Ost und West mit einfädelte. Doch die begehrten Waren kamen nur selten bei den DDR-Bürgern an. Stattdessen versilberte das Politbüro die von der BRD gutgeschriebenen Produkte auf dem Weltmarkt und füllte damit ihre notorisch klammen Konten auf.
Mehr als 3,4 Milliarden D-Mark pumpte Bonn auf diesem Weg in die Staatskassen des SED-Regimes. Laut dem ehemaligen Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski sollen sogar rund acht Milliarden D-Mark in den Osten geflossen sein. Die Bundesregierung, räumt Rehlinger ein, sei bald dahinter gekommen, dass die DDR-Führung die Einnahmen aus dem Häftlingsfreikauf nicht dem eigenen Volk zugute kommen ließ.
Glauben ins System untergraben
Dennoch habe jeder Kanzler, gleich welcher politischen Couleur, an dem Häftlingsfreikauf festgehalten - "aus humanitären Gründen", wie Rehlinger betont. Dass die BRD damit ein Unrechtsregime über Jahrzehnte hinweg stabilisierte, lässt er nicht gelten, im Gegenteil. Man habe die DDR finanziell zwar unterstützt, gesellschaftspolitisch jedoch von innen heraus zersetzt.
Denn das Bewusstsein um die Käuflichkeit der eigenen Regierung, das zum Top-Thema in den DDR-Gefängnissen avancierte und bald auch in der Öffentlichkeit bekannt wurde, habe in hohem Maße den Glauben ins System untergraben. "Der Häftlingsfreikauf war der Sargnagel der DDR", sagt Rehlinger und blickt aus dem Fenster.
Der 84-Jährige wirkt jetzt ein wenig erschöpft. Höflich hilft er der Journalistin in den Mantel und geleitet sie mit dem Auto durch die regennassen Straßen des Kleinstädtchens am Südzipfel Berlins bis zur S-Bahn-Station. Auf der Fahrt dorthin erzählt Rehlinger, wie er damals durch die Chefredaktionen der Bundesrepublik getingelt sei, um die verantwortlichen Journalisten davon zu überzeugen, dass eine Berichterstattung über den Freikauf die Geheimaktionen gefährden würde. Meist habe es geklappt.
"Das war eine andere Zeit", sagt der alte Mann. Dann winkt er und fährt vorsichtig davon.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass Herbert Wehner Bundeskanzler war. Stattdessen ist Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen richtig. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bedanken uns bei unseren Lesern für den Hinweis.
Nachricht aus der „Roten Hölle“ in Bützow - Häftling flieht ins Zillertal - Ausgebüxter Knasti haut Hoteliers übers Ohr
Neubrandenburg

Blick auf das Gefängnis in Bützow. (Foto: Dpa)
Lügenbaron Münchhausen lässt grüßen: Ein entwischter Gefangener aus MV taucht im Zillertal wieder auf und spielt dort den reichen Mann. Er kauft ein Hotel und einen Geländewagen. Geschnappt wird er trotzdem.
Veröffentlicht:21.03.2014 Von: Udo Roll
In Deutschland war er ausgebüxt und zur Fahndung ausgeschrieben – in Österreich tauchte er wieder auf, versuchte dort die nächsten krummen Dinger zu drehen und wurde von der Polizei gefasst: Ein Häftling aus Mecklenburg-Vorpommern ist zwei Wochen nach seiner Flucht in Strass (Zillertal) verhaftet worden. Der 48 Jahre alte Mann habe etwa ein Dutzend neuer Betrügereien begangen, teilte das Justizministerium in Schwerin dazu nüchtern mit.
Amateurkickern versprach er 50 000 Euro
„Der hat die totale Show abgezogen“, fasste dagegen der Dienststellenleiter der Strasser Polizeiinspektion Roland Rainer die Ereignisse der vergangenen Woche zusammen. Im Telefonat mit dem Nordkurier schilderte er auch einige Details: Zunächst hatte sich der mittellose Gauner in zwei Pensionen eingemietet. Bei einem Amateurfußball-Verein spielte sich der Betrüger als Sponsor auf und stellte den Kickern 50 000 Euro in Aussicht. Im Gegenzug ließ er sich mit Essen und Getränken bewirten.
Doch der Betrüger trieb er es noch dreister. Der 48-Jährige erwarb sogar ein Hotel – der Kaufvertrag wurde per Handschlag besiegelt. In einem Autohaus bestellte er laut Polizei einen Luxuswagen für rund 60 000 Euro. Die Karosse war für seine „neue Geschäftsführerin“ gedacht. Es soll sich dabei um eine Hotelmitarbeiterin gehandelt haben, die er zuvor abgeworben hatte. „Er ist rhetorisch nicht unbegabt und hat es gut verstanden, den Leuten etwas vorzugaukeln“, beschreibt Inspektionskommandant Rainer den Kriminellen. Den Leuten habe er unter anderem vorgeflunkert, über einen Millionenbetrag auf einem deutschen Bankkonto zu verfügen.
Betrüger soll nach MV ausgeliefert werden
Geschnappt wurde der Betrüger am Dienstagabend, als er ein weiteres Hotel erwerben wollte. Die Polizei schlug zu, als der Hochstapler gerade mit dem Inhaber das Haus besichtigte. Nach den diversen Vorfällen hatten die Beamten „sehr akribisch und mit Hochdruck ermittelt“, sagte der Inspektionskommandant. Eine Anfrage bei den Kollegen auf deutscher Seite habe dann ergeben, dass es sich bei dem verhafteten Betrüger um einen geflohenen Häftling handelt.
Wann der gefasste Betrüger nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt, ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat Kontakt mit den österreichischen Behörden aufgenommen, um eine Auslieferung zu erreichen. In der Justizvollzugsanstalt Bützow saß der gebürtige Schleswig-Holsteiner wegen Betruges eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten ab. Haft-Ende wäre im Oktober 2014 gewesen. Die Flucht war ihm am 4. März während eines Klinikaufenthaltes in Rostock gelungen. Gegen seinen Bewacher läuft ein Disziplinarverfahren.
Gruseliger Fund in Sachsen - Knochen mehrerer Menschen in JVA entdeckt Von t-online, mtt 30.06.2022

JVA Torgau (Archivbild) Quelle: STAR-MEDIA
Bauarbeiter sind innerhalb des Geländes der Justizvollzugsanstalt Torgau auf menschliche Knochen gestoßen. Das LKA hilft bei den Ermittlungen.
Die Justizvollzugsanstalt Torgau bietet aktuell Platz für rund 400 Häftlinge. Die Geschichte des Gefängnisses reicht weit zurück – und umfasst mehrere düstere Epochen.
Jetzt stießen Bauarbeiter an der nördlichen Mauer der JVA auf menschliche Knochen: "Die Fundstelle befindet sich zwischen der äußeren Umfriedung und der inneren Mauer", teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mit.
Polizei Leipzig: Knochen stammen vermutlich aus 20. Jahrhundert
Nach erster Inaugenscheinnahme durch einen Rechtsmediziner soll es sich um Gebeine mehrerer Menschen handeln. Vermutlich lägen die Knochen schon seit Jahrzehnten in der Erde, hieß es weiter.
Das genaue Alter sei noch unbekannt. Aber: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammen sie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts."
LKA hilft bei Ermittlungen
Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zur Herkunft der Knochen aufgenommen. Herausgefunden werden soll auch, wie die Menschen zu Tode kamen.
Für die Ermittlungen wurde die weitere Freilegung des Ortes angeordnet. Möglich sei, dass noch mehr Knochenteile gefunden werden, teilte die Polizei mit. Die sächsische Bereitschaftspolizei und das Landeskriminalamt sollen die Arbeit unterstützen.
Nazis mordeten in Torgau, Sowjets errichteten Speziallager
Die heutige JVA liegt auf dem Gelände des ehemaligen Fort Zinna. Ab 1890 benutzte die preußische Armee das Fort als Militärgefängnis. Während des Ersten Weltkriegs waren Kriegsgefangene interniert.
1943 verlegten die Nazis ihr höchstes Militärgericht, das Reichskriegsgericht, von Berlin nach Torgau. Zahlreiche Militärangehörige wurden gefoltert, viele Inhaftierte im Wallgraben der Anstalt erschossen.Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Fort Zinna zunächst zum sowjetischen Speziallager, dann zum DDR-Gefängnis und schließlich nach der Wende zu einer der Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen.
Stalag IVB (pegasusarchive.org) Kriegsgefangenenlager Mühlberg/Elbe.
Bilder: Inhaltsverzeichnis 13.c Biographien, Tagebücher Archive der Westalliierten
"Umschulungslager existieren nicht" Andreas Weigelt
Zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 6 in Jamlitz 1945-1947
Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam 2005, 184 Seiten
(Brandenburgische historische Hefte, 16)
Detailgetreu wird die Geschichte dieses sowjetischen Internierungslagers, seiner Errichtung und der späteren Verlegung nach Frankfurt (Oder) beschrieben.
Im Mittelpunkt steht der Lageralltag: Verpflegung, hygienische Bedingungen, medizinische Behandlung, Arbeit, kulturelle Betätigung, aber auch Solidarität und Entsolidarisierung sowie Sexualität. Das Leiden der Häftlinge wird besonders in den Kapiteln über Verhöre, das Spitzelsystem, die Zahl der Toten oder die Fluchtversuche deutlich.
Dem Text ist ein umfangreicher biografischer Anhang beigefügt.
"Umschulungslager existieren nicht" (politische-bildung-brandenburg.de)
Deutschland: Eine verhängnisvolle Affäre Luzerner Zeitung
Beinahe wäre die Flucht geglückt, kurz vor dem Ziel wurden sie jedoch von der Stasi entdeckt. Carl-Wolfgang Holzapfel erinnert sich an das mutige Projekt, einen Tunnel nach Ostberlin zu graben. Nun wurde das Bauwerk zufälligerweise wiederentdeckt.
Christoph Reichmuth, Berlin 28.01.2018
Es ist schrecklich heiss hier unten, in viereinhalb Metern Tiefe. Carl-Wolfgang Holzapfel, 19 Jahre jung, bohrt seinen Spaten in den feuchten Lehmboden, gräbt sich zeitweise mit den blossen Händen in den zähen Boden hinein. Eineinhalb Meter pro Tag in neun Stunden harter Arbeit. Diese tägliche Enge hier unten, einen Meter breit, einen Meter zwanzig hoch. Unmittelbar darüber befindet sich, etwa auf halber Strecke, die Kanalisation von Ostberlin, Holzapfel und seine drei Kollegen reden den ganzen Tag kaum ein Wort miteinander. «Wir hatten Angst, dass man uns drüben im Osten durch die Kanalisation hindurch hören könnte», erinnert sich Carl-Wolfgang Holzapfel, heute 73, als wir ihn diese Woche an der Einstiegsstelle des von ihm gegrabenen Fluchttunnels beim Berliner Mauerpark treffen. «Ich kann Ihnen bis heute nicht sagen, wie wir das damals geschafft haben.»
Den nahezu 80 Meter langen Tunnel von West- nach Ostberlin gruben Holzapfel und drei Kollegen zwischen März und Juni 1963. Vor wenigen Tagen haben Bauarbeiter an der Grenze zwischen den Stadteilen Prenzlauer Berg und Wedding den längst vergessenen Fluchttunnel zufälligerweise freigelegt. In Fachkreisen gilt der Fund als Sensation. Zum Vorschein gekommen ist der Einstieg des Tunnels, sind Grundmauern eines Gebäudes auf dem ehemaligen Güterbahnhof, Überreste eines mehr als 20 Tonnen schweren Betonblocks mit massiven Stahlträgern, Panzersperren der DDR-Grenztruppen. «Der gute Zustand der freigelegten Überreste ist für die Innenstadt einzigartig», sagt der Berliner Archäologe Torsten Dressler. Der 50-Jährige will die tragische Geschichte des Tunnelbaus rekonstruieren, nach Ende der Bauarbeiten sollen die Ausgrabungen in die Mauer-Ausstellung integriert werden.
21 Fluchtwillige flogen auf
Carl-Wolfgang Holzapfel ist in Westberlin Anfang der 1960er-Jahre ein bunter Hund, kurz nach dem Bau der Berliner Mauer im Sommer 1961 tritt er in tagelange Hungerstreiks, gedenkt der ersten Maueropfer mit Holzkreuzen, die er in Sichtweite der DDR-Grenzposten aufstellt. Per Megafon ruft er beim Mauerstreifen zur Wiedervereinigung auf, zum Abbau der Mauer, zur Niederlegung der Waffen an der Grenze. Der damals regierende Berliner Bürgermeister Willy Brandt unterstützt den unerschrockenen jungen Westberliner, der Publizist Rainer Hildebrandt wird 1962 auf den umtriebigen Holzapfel aufmerksam, macht ihn zum Leiter seiner Ausstellung in der Bernauer Strasse, die sich mit den ersten Toten der Berliner Mauer auseinandersetzt.
Dort trifft Holzapfel auf einen jungen Mann, der sich ihm als Gerhard Weinstein vorstellt. Weinstein erzählt von seinem persönlichen Drama, seine zweijährige Tochter Liane ist in Ostberlin, er hat sie seit dem Bau der Mauer vor fast zwei Jahren nicht sehen dürfen. Weinstein weiht Holzapfel in seine Pläne ein, am Mauerstreifen bei der Eberswalder-/Oderbergerstrasse einen Tunnel zu graben. Die Stelle beim alten Güterbahnhof ist besonders geeignet für ein solch waghalsiges Projekt. Keinen Meter hinter der Mauer befindet sich auf westlicher Seite ein alter Geräteschuppen, dieser bietet Schutz vor den Blicken der Grenzwächter. Bis zu einem Gebäude auf der Ostseite sind es nur rund achtzig Meter. Weinstein erzählt, man wolle sich bis zum Keller dieses Hauses durchgraben, die Mauer durchbrechen und fast 20 Leute, darunter die kleine Tochter und deren Grosseltern, in den Westen holen. «Ich zögerte keine Sekunde, gab die Arbeit in der Ausstellung auf und schloss mich dem Projekt an», erinnert sich Holzapfel. Wenige Tage nach dem Gespräch, im März 1963, geht es los. Die vier jungen Männer schaffen Schaufeln und Feldbetten mitten in der Nacht herbei, verstecken die Utensilien im Schuppen, graben sich in aller Stille viereinhalb Meter in die Tiefe. Nahe dem Tunneleinstieg erstellen sie ein Feldbetten-Lager und installieren mit Notkochern eine kleine Küche. «Wir sind, damit die Grenzwächter keinen Verdacht schöpfen konnten, immer am späten Sonntagabend in den Tunnel gestiegen und haben diesen erst in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder verlassen.» Überirdisch haben sie Unterstützer, die sie mit wichtigen Informationen versorgen.
Projekte für einen Fluchttunnel gab es in den ersten Jahren nach dem Mauerbau etliche, erzählt Archäologe Dressler. In Berlin wurden etwa 75 solcher Tunnels gegraben, allerdings waren lediglich 25 Tunnelprojekte erfolgreich. «Zwischen 350 und 450 Menschen sind über Tunnelsysteme von Ost nach West geflüchtet», erzählt Dressler. Weit über 500 Fluchtwillige sind bei ihrem Versuch allerdings gescheitert, die meisten wanderten für Jahre in Stasi-Gefangenschaft, etwa fünf Menschen fanden in den selbst gebauten Tunnelsystemen den Tod. Mitte der 1960er-Jahre entspannte sich das Verhältnis zwischen Ost und West marginal, durch kleinere Lockerungen war es ausgewählten Ostberlinern möglich, Verwandtschaft im Westen zu besuchen. Die Fluchttunnels wurden daher zunehmend vom Westberliner Senat unterbunden. «Der Westen wollte kleine Fortschritte nicht gefährden», sagt Dressler.
Pläne im Bett ausgeplaudert
Gescheitert ist auch das Fluchtprojekt, an dem Carl-Wolfgang Holzapfel vier Monate hart geschuftet hatte. Direkt vor dem Durchbruch zum Haus an der Eberswalderstrasse 1. Aufgeflogen sind die mutigen Fluchthelfer durch einen Umstand, der ärgerlicher kaum sein könnte. Einer der vier Tunnelbauer agierte gleichzeitig als Kurier im Osten, wo er das gegenüberliegende Gebäude auskundschaften und die Fluchtwilligen über den Stand der Arbeiten informieren sollte. Der junge Mann namens Hans vergnügte sich bei seinen Ost-Besuchen allerdings auch mit einer verheirateten Ostberlinerin. «Die beiden hatten eine leidenschaftliche Affäre», erzählt Holzapfel heute. «Leider hat Hans gegenüber seiner Freundin die ganzen Tunnelpläne ausgeplaudert. Das war insofern dumm, weil die Frau sich gegenüber einem DDR-Grenzwächter offenbarte.» Hans und die Tunnelbauer flogen auf, der Kurier wurde bei seinem nächsten Boten-gang nach Ostberlin von der Staatssicherheit verhaftet.
Holzapfel und die verbliebenen Kollegen konnten sich dem Zugriff der Stasi im letzten Moment durch die sofortige Einstellung der Arbeiten entziehen. Ein Westberliner Polizist berichtete, dass vor dem Gebäude auf der Ostseite die DDR-Post ein Zelt aufbaue. «Das machte ihn stutzig. Als er die Sache genauer unter die Lupe nahm, erkannte der Polizist, dass die angeblichen Postboten unter ihren grauen Kitteln schwere Militärstiefel trugen. Die Aktion wurde sofort abgebrochen.» 21 Menschen wanderten für bis zu drei Jahre in Stasi-Haft – wie Hans, der redselige Bote –, und Weinsteins Tochter wurde in ein Kinderheim gesteckt. Er sollte seine Tochter Liane viele Jahre nicht sehen, insgesamt waren sie durch die Mauer elf Jahre lang getrennt.
Acht Jahre Zuchthaus
Holzapfel hat die Mauer bis zum Ende der DDR bekämpft, am 18. Oktober 1965 wurde er am Checkpoint Charlie durch Grenzposten der DDR verhaftet und für seine Mithilfe beim Fluchttunnel wegen «versuchter Beihilfe zur Republikflucht» zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach über einem Jahr in Haft, davon neun Monate in einer Isolationszelle im zentralen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, wurde Holzapfel vom Westen freigekauft. Der Politaktivist und spätere Bankkaufmann liess sich durch die Haft nicht beeindrucken und machte mit weiteren Aktionen an der Grenzmauer auf «das Unrecht», wie er sagt, aufmerksam. Zuletzt kurz vor dem Fall der Mauer, als er sich am 13. August 1989 flach auf den Grenzstreifen in Berlin legte, Rumpf und Kopf im Osten, von der Hüfte abwärts im Westen. Heute lebt er mit seiner aus Ostberlin stammenden Lebensgefährtin Tatjana Sterneberg, die ebenfalls Jahre in Stasi-Haft verbracht hatte, in Berlin. «Wir sind die gelebte Wiedervereinigung», sagt er mit einem Lachen. Auf den unvorsichtigen Botengänger Hans, dessen Techtelmechtel in Ostberlin den Fluchttunnel zum Scheitern gebracht hatte, ist Holzapfel heute nicht mehr böse. «Wir waren junge Leute und hatten Flausen im Kopf. Dass er mit einer Frau im Bett gelandet ist und mit dem Tunnelbau geprahlt hat», sagt er und schliesst, «nun ja, es ist passiert.»

Kamerad Helmut Schubert und Monique besuchen mich am Mahnmal.

Die kaputte Carina Stein aus Hamburg treibt sich wieder am Reichstag herum.

Der klägliche Rest meines Bücherstandes.

Kameradin Brigitte Bielke besuchte mich zu Hause.

Großdemo am Reichstag








Der Kranz zum 17. Juni vom Spendengeld finanziert.

Kränze des Hauses am Checkpoint Charlie und der AfD.





Rechts:
Kranz zum Volkstrauertag 2021 vom Spendengeld finanziert.




Links:
Vom Spendengeld finanzierter Kranz und der des Hauses am Checkpoint Charlie 2023.

Links:
Kranz der AfD




Links:
Gustav Rust im Rollstuhl am 13.8.2021


Schon wieder reißen die Betonklötze des Holocaust-Mahnmals. Die Bauindustrie freut sich - der Steuerzahler zahlt.






Quittungen für die letzten Kränze am Mahnmal vom Spendengeld.

Am Sonntag, dem 3.9.2023 fuhr mich mein Sohn Olaf nach Baruth/Mark zu Hartmut Langer.
Rechts:
Nach der Rückkehr.





Kränze der Parteien zum 13. August 2023.


Linke Klimafanatiker schändeten wiederholt das Brandenburger Tor.

